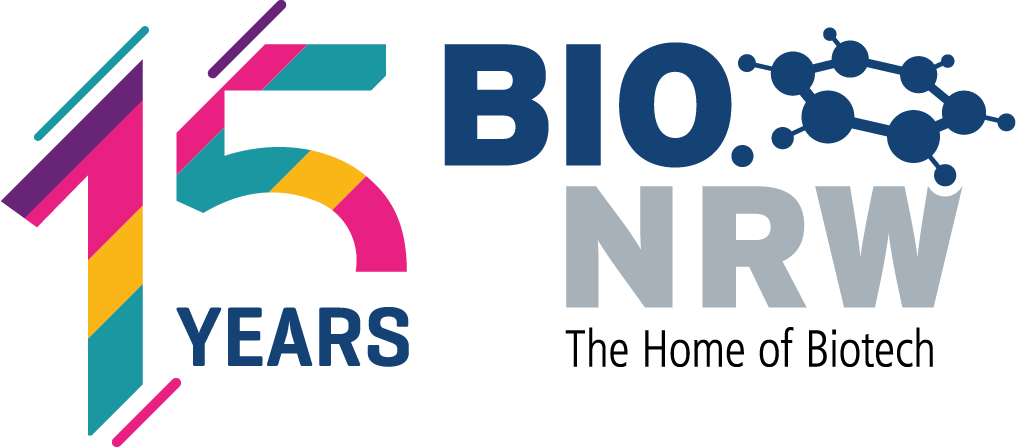Neue Ideen für die Diagnostik der Zukunft
Leben rettet, wer Viren, Bakterien, Tumormarker oder gefährliche Umweltgifte rasch und präzise nachweisen kann. Zwei innovative Projekte, von der Stiftung im Corona-Kontext gefördert, zeigen, wie neue Ideen die Diagnostik verbessern.
Dieser Beitrag entstand für das Magazin IMPULSE der VolkswagenStiftung, Ausgabe 2021, Juni 2021
Autorin: Ulrike Gebhardt; Fotos: Felix Schöppner.
Fluoreszierende Nanosensoren oder eine günstigere Alternative zur klassischen PCR – neue diagnostische Verfahren könnten schnelle Ergebnisse liefern und überall auf der Welt verfügbar sein. Zwei ganz unterschiedliche, zukunftsweisende Projekte stellen wir Ihnen hier vor.

Leuchtende Nanoröhrchen statt langwieriger Tests
Mit einem Wattestäbchen entnimmt der Sanitäter vorsichtig eine Probe aus der Nase des älteren Herrn. Wir haben Szenen wie diese x-mal in den Nachrichten gesehen oder es bereits am eigenen Leib erlebt: Um das Coronavirus Sars-CoV-2 im Körper eines Menschen nachzuweisen, braucht es einen Abstrich aus dem Nasen-Rachenraum. In dieser Probe wird dann das Erbgut des Virus mit Hilfe der PCR-Methode (sehr genau, aber zeitaufwändig) nachgewiesen oder einzelne Eiweißbausteine des Virus über einen Antigen-Schnelltest (nicht so genau, aber schnell).
Sebastian Kruss, Biophysiker an der Ruhr-Universität Bochum, hat etwas anderes vor. Ob Viren wie Sars-CoV-2 oder Bakterien ihr Unwesen treiben, das will er direkt im Körper der Infizierten oder unmittelbar in Blut- oder Speichelproben nachweisen – schnell und unkompliziert, ohne aufwändige Aufbereitung von Proben.
Projektleiter Sebastian Kruss wird bereits seit 2017 von der Stiftung bei der Entwicklung von fluoreszierenden Nanosensoren im nahen Infrarot für Krankheitserreger wie Bakterien unterstützt. Für die aktuelle Forschung in diesem Kontext bewarb er sich erfolgreich um ein sogenanntes “Corona-Zusatzmodul”.
Noch befinden sich seine Forschungen im Grundlagenstadium. Doch sollten Kruss, der zuvor an der Universität Göttingen tätig war, und die anderen beteiligten Forschenden aus Physik, Chemie und Lebenswissenschaften weiter so gut vorankommen wie bisher, wird es in der Diagnostik dank winziger, leuchtender Nanoröhrchen bald ungeahnte neue Möglichkeiten geben. Wie funktioniert die Methode, wo wäre ein Einsatz denkbar?
Sensoren zeigen, wenn Viren “in die Falle” gehen
Herzstück der neuen Nachweis-Methode sind winzige Kohlenstoff-Röhrchen, die einen Durchmesser von weniger als einen Nanometer haben. Werden diese Nano-Röhrchen, die man durch Verbrennung etwa von Methan gewinnt, mit Licht bestrahlt, fangen sie an zu leuchten. Dieses Leuchten kann das menschliche Auge zwar nicht sehen, weil es im “Nah-Infrarot” und nicht im sichtbaren Lichtwellenbereich liegt. Spezielle Kameras können das Leuchtsignal der dünnen Röhren aber “lesen”.

Im Labor von Sebastian Kruss werden Nanosensoren unter dem Fluoreszenzmikroskop mit grünem Licht angeregt.
Die Nanoröhrchen sind die leuchtenden Bauteile eines Sensors. “Entscheidend für seine Funktion ist jedoch die organische Phase um das Röhrchen herum, die zum Beispiel aus Antikörpern oder anderen Erkennungsmolekülen bestehen kann”, sagt Sebastian Kruss. Die Röhrchen werden also mit einer Art “molekularer Haftschicht” umgeben, die Viren, Bakterien oder auch deren Stoffwechselprodukte selektiv erkennen und binden kann.
Sobald ein Virus oder ein Bakterium in die Falle geht, das heißt, wenn die Erreger über das “Fängermolekül” an das Nanoröhrchen gebunden werden, verändert sich das Leuchten der Röhrchen, die mit Licht angestrahlt werden. Diese Veränderung erscheint als positives Testsignal. Leuchten die Röhrchen jedoch unverändert wie zuvor, sind die vermuteten Erreger oder Substanzen nicht anwesend.
Vielfältig einsetzbar
Die Sensoren, die man sich wie einen winzigen Schlauch oder eine Nudel vorstellen kann, können für Labortests, aber auch für Nachweise im lebenden Organismus eingesetzt werden. Je nachdem, mit welcher Erkennungsfunktion die winzigen Röhrchen ausgestattet sind, lassen sich mit ihnen verschiedene Bakterien oder Viren, genauso aber auch Signalstoffe, Tumormarker, Antikörper, Blutzucker, Neurotransmitter, Insulin oder andere Hormone aufspüren.
Ein Vorteil der Methode ist ihre Schnelligkeit. Das Ergebnis ist sofort da. Blut-, Urin- oder Speichelproben könnten auf die Sensoren geträufelt werden, um darin Krankheitserreger oder Biomarker nachzuweisen, die auf eine Infektion, eine Entzündung oder auch ein Tumorleiden hinweisen. “Nanosensoren könnten zum Beispiel auch die Diagnose einer Sepsis beschleunigen, ein lebensbedrohlicher Zustand, in dem jede Minute zählt”, erklärt Professor Kruss.
Besonders attraktiv ist, dass die Sensoren direkt auf beispielsweise künstliche Hüftgelenke oder auch Katheter aufgebracht werden könnten. Befinden sich diese “Ersatzteile” oder medizinischen Gerätschaften erst einmal im menschlichen Körper, ist es schwierig rechtzeitig zu bemerken, wenn sich gefährliche Bakterien als Biofilm auf den Materialien niedergelassen haben.
Ein Nanosensor auf dem künstlichen Gelenk aber würde sofort “anschlagen”, sobald sich unerwünschte Bakterien ausbreiten. “Der Vorteil der Technik ist, dass die Nanoröhren im Nah-Infrarot-Bereich leuchten, ein Bereich, der so gut wie gar nicht durch ein Hintergrundsignal des umgebenden Gewebes gestört wird”, sagt Sebastian Kruss. Das optische Signal kann das Körpergewebe bis zu einem Zentimeter durchdringen, da es kaum von Wasser, Zellen oder Blut absorbiert oder gestreut wird. Eine Kamera könnte dann durch die unversehrte Haut hindurch in den Körper “blicken” und das Signal, das die Sensoren senden, erfassen.
An dem Prototyp einer solchen Kamera arbeitet Kruss gerade zusammen mit einem Team am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Systeme und Schaltungen in Duisburg. Im Prinzip könnte das Leuchtsignal aber auch von einer Handy-Kamera erfasst werden. Noch klingt diese Anwendung zwar ein wenig nach Science-Fiction, aber ganz so unwahrscheinlich ist es nicht, dass wir zukünftig mit Hilfe eines entsprechenden Nanoröhren-Testkits und einer App auf dem Smartphone herausbekommen könnten, ob wir mit Sars-CoV-2 oder anderen Erregern infiziert sind oder nicht.

Diagnostik für alle – LAMP-PCR
Wer hierzulande die molekularen Zutaten für den Labornachweis von Viren oder Bakterien bestellt, erhält die benötigen Enzyme und Reagenzien meist schon am nächsten Tag. “Fordern dagegen die Kolleginnen und Kollegen in unserer Partner-Universität in Addis Abeba diese Test-Enzyme bei den Herstellerfirmen an, müssen sie meist ein bis zwei Monate darauf warten und zahlen einen drei- bis vierfachen Preis”, sagt Johannes Kabisch von der Technischen Universität Darmstadt. In einem kooperativen Projekt mit Forschenden der Universität Cambridge und des Ethiopian Biotechnology Institute arbeitet Kabisch gegen diesen Missstand an: Wie können molekulare Werkzeuge, die es etwa für eine Virus-Diagnostik braucht, in Ländern mit wenig Ressourcen hergestellt werden? “Wir wollen die Technologie dort hinbringen, wo sie gebraucht wird”, umreißt der Biotechnologe einen Kerngedanken des Projekts.

Johannes Kabisch nutzt im Labor einen Pipettierroboter für Virus-Tests. Ziel des Projektes ist jedoch, Erregern mit möglichst wenig Hightech auf die Spur zu kommen. Ab Sommer 2021 setzt der Biologe seine Forschung an der NTNU in Trondheim fort.
Sein Ansatz: Statt des klassischen PCR-Tests zum Nachweis von Viren oder anderen Erregern wird zum einen ein etwas verändertes Verfahren genutzt, das schneller, einfacher und günstiger ist, die so genannte “LAMP-PCR”. Zum anderen unterliegen die für den Test benötigten Enzyme beziehungsweise der genetische Bauplan keinem Patent, sondern entstammen der in Cambridge beheimateten “Open Enzyme Collection“, einer Art “Wikipedia für Enzyme”. Johannes Kabisch betont: “Das Open Bioeconomy-Lab der Universität Cambridge unterstützt das Projekt nicht nur durch seine Datenbank patentfreier Gensequenzen für Biomoleküle, sondern auch durch seine Erfahrungen und Netzwerke zu Biotechnologie-Laboren im globalen Süden.”
Für ein schnelles Ja oder Nein
Die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) vervielfacht die Erbinformation der verdächtigten Erreger, beziehungsweise von Abschnitten daraus, und macht sie in der untersuchten Probe durch vielfaches Kopieren und Anfärben schließlich sichtbar. Bei der klassischen PCR wechseln sich hohe und niedrige Temperaturen ab; es wird daher ein so genannter Thermocycler benötigt.
Theoretisch braucht man lediglich ein Wasserbad
“Die LAMP-PCR läuft dagegen bei einer konstanten Temperatur. Theoretisch braucht man für die Durchführung kein teures Gerät, sondern lediglich ein Wasserbad, das die Temperatur auf 63 Grad Celsius hält”, erklärt Kabisch. Ein positives Ergebnis ist bei diesem Test durch einen Farbumschlag in der Probe schon nach einer halben Stunde zu erkennen. Bei der üblichen PCR dauert es ungefähr drei bis 24 Stunden bis das Ergebnis feststeht.
Bislang war die LAMP-PCR der klassischen Variante aber deutlich unterlegen. Sie war nicht so robust und nicht so sensitiv. Inzwischen ist die Methode von Forschenden weltweit verbessert worden. “Die LAMP-PCR gibt eine zuverlässige Ja- oder Nein-Antwort, zeigt also an, ob in der Probe der verdächtigte Erreger enthalten ist oder nicht”, sagt Kabisch. Künftig könne die Technik eine gute Alternative werden. Exakte Angaben über die Menge der Viren oder Bakterien liefere sie jedoch nicht.
Der Clou sind bioproduzierte Enzyme
Die Herstellung der Enzyme, die für die LAMP-PCR benötigt werden, übernehmen Bakterien der Sorte Bacillus subtilis. Deren Erbgut wird gentechnisch so verändert, dass sie die Enzyme “Reverse Transkriptase” oder eine “Polymerase” herstellen. Das erste Enzym wird hierbei für die Detektion von RNA-Viren wie Sars-CoV-2 benötigt. Es übersetzt RNA in DNA, welche dann mit dem zweiten Enzym, einer Art molekularem Kopierer, vervielfältigt und dadurch sichtbar gemacht werden können.
…die Bakterien machen die ganze Arbeit.
Auch bei einer herkömmlichen Produktion stellen Bakterien diese Enzyme her. Sie werden dann jedoch aus den zertrümmerten Bakterienzellen aufgereinigt. “Bei der von uns gewählten Produktionsweise machen die Bakterien die ganze Arbeit”, sagt Johannes Kabisch. Sie stellen die Enzyme her und werden dann durch veränderte Kulturbedingungen dazu gebracht, in einen Dauerzustand, die Bakterienspore, überzutreten. Der Clou bei dieser Technik: “Die Spore trägt auf ihrer Oberfläche das gewünschte Enzym, sie bringt ihre Mutterzelle sogar selber um, und für die Aufreinigung der an die Sporen gehefteten Enzyme reicht eine einfache Zentrifugation”, sagt der Forscher aus Darmstadt.
Die Enzyme sind nicht nur leichter und kostengünstiger herzustellen, sie sind wegen der Kopplung an die Sporen auch stabiler und halten sich selbst bei Raumtemperatur etwa drei Monate lang. Bevor diese durch eine Bioproduktion gewonnenen Enzyme in der Diagnostik ankommen, muss jedoch noch allerhand Feinarbeit geleistet werden, Testprotokolle müssen geprüft und für zuverlässig befunden werden. “Durch sorgfältiges Einstellen des Produktionsprozesses und Austesten der gewonnenen Enzyme werden wir zuverlässige Testsysteme entwickeln können”, ist sich Kabisch sicher. Er hofft, nach einem erfolgreichen Wissenstransfer von Darmstadt beziehungsweise Cambridge nach Addis Abeba in nicht allzu ferner Zeit dort ausreichend Enzyme für 10.000 Prototypen eines Sars-CoV-2 Testkits herstellen zu können.